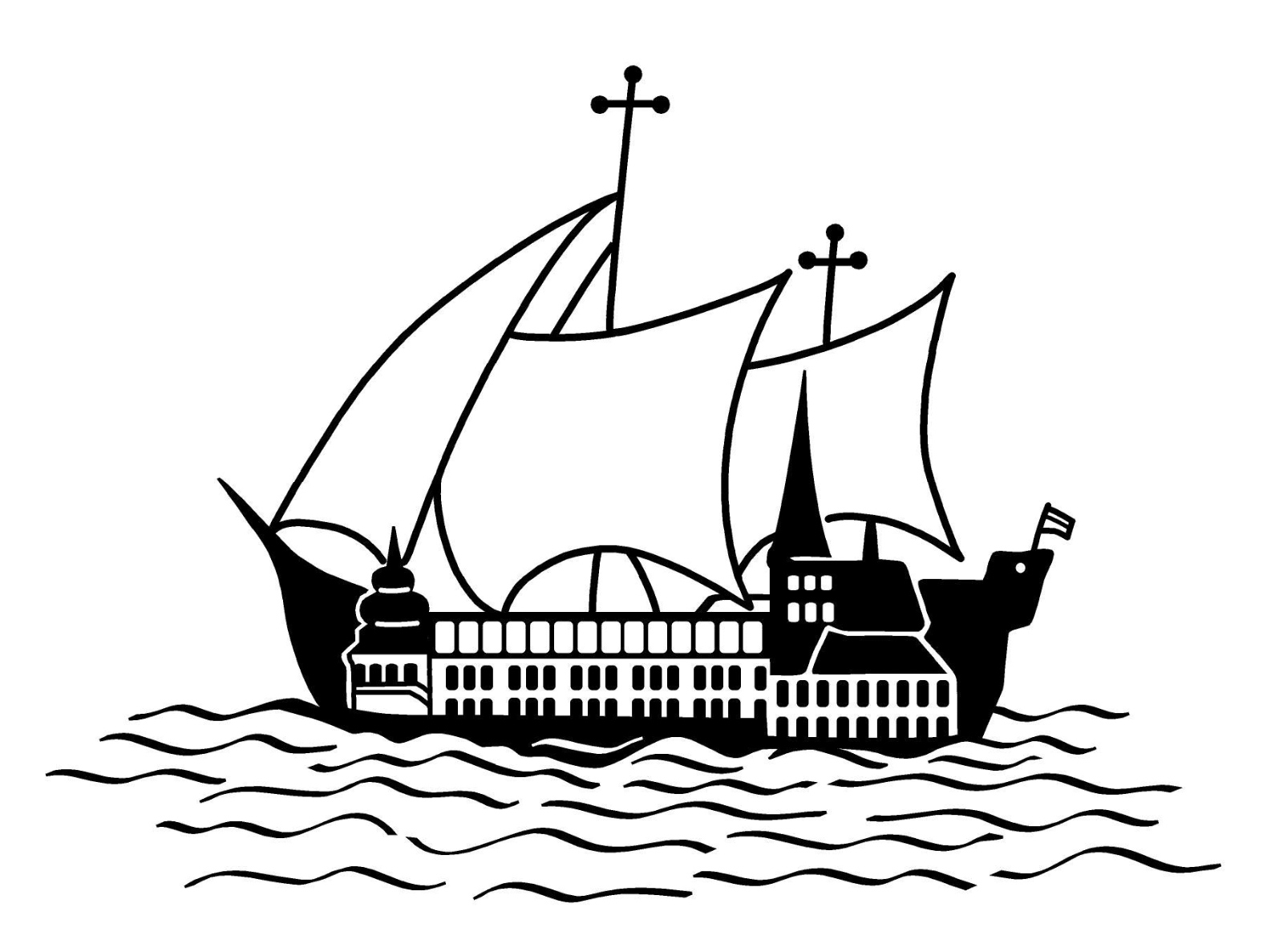Der Deutsch-Grundkurs der Q2 untersucht den Einfluss von sozialen Medien auf die bevorstehende Bundestagswahl:„Informationshagel oder Goldregen?“ Sind die sozialen Medien Retter oder Gefährder der Demokratie?

In ihrer Klausur haben sich die Schülerinnen den Kurses auf Grundlage folgender Materialien mit der Frage nach der Relevanz sozialer Medien in der Demokratie auseinandergesetzt und einen eigenen Kommentar dazu geschrieben.
- M1: Kneuer, Marianne: Politische Kommunikation und digitale Medien in der Demokratie (2017)
- M2: Weisband, Marina: Digitalisierung: Wie retten wir das Internet und machen jungen Menschen wieder Lust auf Demokratie? (21. Juli 2021)
- M3: Pörksen, Bernhard: Clash der Codes – oder das Zeitalter der indiskreten Medien (2018)
- M4: Zerstört die Political Correctness die Debattenkultur? - Anatol Stefanowitsch im Gespräch mit dem Redakteur Axel Rahmlow.
- M5: Shell Jugendstudie 2024, Statistiken zum Vertrauen und Nutzung von Medien
Zur Information und zur eigenen Meinungsbildung haben sich einige Schülerinnen des Kurses bereit erklärt, ihre Kommentare zu veröffentlichen. Herzlichen Dank dafür!
Informationshagel oder Goldregen? Die sozialen Medien als Retter und Gefährder der Demokratie - Von Merle W., Q2
„Olaf Scholz verliert die Vertrauensfrage“, „Donald Trump wird nächster US-Präsident“, „Artet der Nahostkonflikt aus?“. Egal ob in der Tagesschau, in der Zeitung oder auf TikTok, wir alle werden ständig mit Unmengen an Informationen und Meinungen konfrontiert. Doch woher sollen wir wissen, welche Informationen wirklich wichtig sind, wie wir uns bei dieser Menge eine Meinung bilden sollen und welche Auswirkungen dies auf unsere Zukunft hat?
Das Motto unserer Schule ist „Mädchen stark machen“ und ein ganz wichtiger Schritt, dieses Ziel zu erreichen, ist die Fähigkeit, zu einem Thema Stellung zu nehmen und seine eigene Zukunft mitzubestimmen.
Statistiken zeigen eindeutig, dass Printmedien in den letzten Jahren drastisch an Bedeutung verloren haben. Wer liest heutzutage schon noch Zeitungen? Richtig, Eltern und Lehrer vielleicht. Deshalb wollen wir uns heute mit einem Thema auseinandersetzen, mit dem sich besonders Schülerinnen auskennen, und das auch in anderen Generationen an Bedeutung gewinnt: die sozialen Medien.
Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl möchte ich euch die Debatte um Social Media als „Retter oder Gefährder der Demokratie“ näherbringen. Ziel ist es, euch einen sicheren Umgang mit Medien zu ermöglichen, der euch zu besser informierten Wählern und Wählerinnen macht.
Im Unterricht haben wir verschiedene Ebenen der politisch-gesellschaftlichen Kommunikation beleuchtet. Das hört sich erstmal kompliziert an, wird aber sehr interessant, wenn man sich vor Augen führt, wie sehr man mit seiner Teilhabe an Debatten das politische Geschehen und somit seine eigene Zukunft gestalten kann.
Ich bin der festen Überzeugung, dass soziale Medien durch freie und für jeden zugängliche Debatten das demokratische Bewusstsein der Menschen stärken können, dies jedoch immer mit Gefahren wie Fehlinformationen oder Hass und Ausgrenzung einhergeht.
Ich denke sogar, dass soziale Medien ohne gewisse Einschränkungen sogar unsere Demokratie gefährden. Doch wie komme ich zu dieser Haltung?
Ich denke, dass ihr euch dafür erst klar machen müsst, was Demokratie für euch bedeutet. Ich bin kein SoWi-Buch, die genaue Definition kann ich euch also leider nicht nennen, aber mir persönlich liegt besonders die Gleichheit aller Menschen und die Freiheit, meine Meinung ungehindert zum Ausdruck zu bringen (solange sie niemandem schadet), sehr am Herzen.
In diesem Sinne würde ich behaupten, dass soziale Medien auf den ersten Blick demokratisch sind. Jeder hat theoretisch Zugang zu verschiedenen Plattformen und kann seine Meinung äußern, weshalb auch die Kommunikation verschiedener politischer Interessen und Positionen möglich ist. Darüber hinaus hat sich mit dem enormen Bedeutungsanstieg ein zweiter gesellschaftlicher Raum gebildet, in dem es den verschiedensten Gruppen wie Bürgern, Parteien, Politikern oder Organisationen möglich gemacht wird, sich zu verständigen und zu diskutieren. Das ist im „realen“ Leben eher schwierig, der Austausch zwischen sozialen Gruppen wird also durch soziale Medien gefördert.
So kann sich also eine öffentliche Meinung bilden, die für die Politik unbedingt notwendig ist, da sie ohne die Rückmeldung der Bevölkerung nicht funktioniert. Außerdem kann durch die öffentliche Meinung eine Begründung beziehungsweise „Legitimierung“ des politischen Handelns stattfinden.
Ihr habt bestimmt im Unterricht schon mal von der Gewaltenteilung in Demokratien gehört, die die Regierung auf verschiedenen Ebenen kontrolliert. Manche Menschen sehen die Medien sogar als „vierte Gewalt“ und Kontrollinstanz an, da sie den Bürgern die Möglichkeit gibt, der Regierung die Meinung der Gesellschaft widerzuspiegeln.
Die Tatsache, dass fast jeder Zugang zu sozialen Medien hat, hat jedoch auch Nachteile, die man unter dem relativ komplizierten Begriff der „Indiskretion“ der Medien zusammenfassen kann. Er beschreibt die Allgegenwärtigkeit, also das ständige Vorhandensein und Teilen von verschiedensten Informationen.
Kennt ihr die Szene im ersten Teil von Harry Potter, als das ganze Haus mit Briefen von Hogwarts gefüllt wird? So fühlt ihr euch vielleicht, wenn ihr täglich mit Unmengen an Nachrichten überschüttet werdet. Natürlich ist es gut, wenn es viele Wege gibt, über die Politik kommuniziert wird. Das kann jedoch dazu führen, dass die Art der Kommunikation qualitativ schlechter wird. Je schneller Informationen geteilt werden, desto mehr Fehlinformationen entstehen auch aus dem Kontext gewisser Nachrichten.
Außerdem wird nur wenig kontrolliert, was Menschen teilen. Wenn ein Mensch in Japan beispielsweise etwas Schlimmes erlebt und teilt, könnt ihr verstörende Inhalte eventuell durch die Medien miterleben, wodurch die emotionale Distanz zu Ereignissen verloren geht. Da euch so viele schlechte Nachrichten erreichen, fühlt ihr euch vielleicht ständig irritiert und habt gar keine Lust mehr auf die Nachrichten und Politik, was für die Demokratie natürlich nicht förderlich ist.
Manche Unternehmen versuchen sogar eine „Emotionsindustrie“ aufzubauen. Das bedeutet, dass Dinge, die Menschen aufregen oder verängstigen, verstärkt publiziert werden, um durch Emotionen mehr Aufrufe und somit Einnamen zu generieren.
Apropos Emotionen: Besonders Hass ist in den sozialen Medien sehr präsent. Egal ob unter Tagesschaubeiträgen oder harmlosen Comedy-Videos, Beleidigungen sind überall zu finden. Da sich Menschen aufgrund ihrer Anonymität im Netz nicht zeigen müssen, werden Anfeindungen verstärkt. Dies führt nicht nur zu einem Politikverdruss in der Gesellschaft und besonders bei Jugendlichen, sondern auch zu Angst, seine Meinung zu äußern. Das sollte in einer Demokratie niemals der Fall sein und ist deswegen für unsere Zukunft sehr gefährlich. Das Gefühl, sowieso nichts ändern zu können, sollte nicht bestehen.
Aktionen wie „Fridays For Future“ zeigen jedoch, dass die sozialen Medien definitiv einen Weg bieten können, etwas in der Welt zu verändern.
Im Kontext der Debatten habe ich bereits erwähnt, dass die sozialen Medien die Verbindung zwischen sozialen „Schichten“ fördern. Das stimmt auch, wenn man jedoch zur Kenntnis nimmt, dass bereits unterdrückte Gruppen Angst davor haben, ihre Meinung zu äußern, erkennt man schnell ein großes Problem.
Andere Experten nennen das Argument, dass die Digitalisierung unsere Demokratie gar nicht großartig verändert, da sie bereits existierende Meinungen nur verstärkt. Das sehe ich nicht ganz so, da die Polarisierung, also das Auseinanderdriften von Meinungen, eine Debatte zwischen Oppositionen (Menschen mit verschiedenen Meinungen) verhindert. So kann es nur schwer zu Kompromissen kommen, die unsere Demokratie weiterbringen.
Eine solche Debatte ist die der „Political Correctness“, die besagt, dass Ausdrücke und Handlungen vermieden werden sollten, die Gruppen von Menschen kränken oder beleidigen. Manche Menschen interpretieren diese Idee als Einschränkung, da sie vermehrt auf ihre Ausdrucksweise achten müssen, um Widerspruch in der Bevölkerung zu vermeiden. Die Kulturstaatsministerin denkt beispielsweise, dass die Angst etwas Falsches zu sagen, der Demokratie schadet, und eher neutralen Bürgern den Mund verbietet, ohne etwas gegen Extremisten zu tun. Besonders Äußerungen von Politikern werden so zunehmend riskanter, da sie sich in einer Zwickmühle zwischen erwarteter Perfektion und Authentizität befinden.
Ich bin jedoch der Meinung, dass diese Korrektheit die Demokratie und Gleichheit aller Menschen fördert, da sie alle Menschen würdigt, Minderheiten sichtbar macht und ihnen die Möglichkeit gibt, für ihre Rechte einzustehen.
In der Zukunft muss es also eher darum gehen, Verbündete und Kompromisse zu finden, anstatt sich immer weiter von seinem politischen Gegner zu entfernen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die sozialen Medien einen guten Ort des Austausches in der Gesellschaft bilden, der für die Demokratie extrem wichtig ist. Um Fehlinformationen, Hass oder Ausgrenzung zu vermeiden, muss es jedoch Kontrollinstanzen und Richtlinien geben, die einen friedlichen Austausch garantieren.
Jugendliche tendieren immer noch dazu, den traditionellen Medien mehr zu vertrauen, obwohl sie diese seltener nutzen. Da unser Alltag aber zunehmend von sozialen Medien abhängig ist, müssen wir in Zukunft also auch dort dafür sorgen, dass unsere Meinungsfreiheit nicht gefährdet wird, und der Informationshagel zu Goldregen für unsere Demokratie wird.
Merle W., Q2
Politik und Social Media? Wie hängen die beiden zusammen? - Von Ferah A., Q2
Liebe Schülerinnen der USH,
vorbereitend auf die Jugendwahlen, welche ja durch die vorgezogene Bundestagswahl nun früher stattfindet als geplant, werde ich euch im Folgenden etwas zur Beeinflussung eurer Meinungsbildung durch soziale Medien erzählen.
Soziale Medien sind ohne Zweifel ein großer Teil unseres Alltags. Besonders für junge Menschen sind Apps wie Twitter, TikTok etc. nicht mehr wegzudenken. Eine Studie zeigt, dass mit der zunehmenden Nutzung des Internets auch das Vertrauen in Apps, die nicht ursprünglich für den politischen Austausch geschaffen wurden, wächst (vgl. M5). So zum Beispiel ist die Zahl der Jugendlichen, welche den Nachrichten auf Entertainment und Diskurs-Apps vertrauen innerhalb der letzten 5 Jahre um rund 5-10% gestiegen. Doch nicht nur Jugendliche sind betroffen; während die Zahlen der traditionellen Papierzeitungsleser und derer, welche ihre Nachrichten online lesen, gerade noch einigermaßen im Einklang liegen, besagen Prognosen, dass sich dies innerhalb der nächsten drei Jahre drastisch ändern wird. Während noch im Jahr 2019 2/3 der Gesellschaft Papierzeitungen gelesen haben, werden diese Zahlen vermutlich bis 2027 auf nur noch knapp über 1&3 zurückgehen. Generell lässt sich auch erkennen, dass sich die Zahl der Zeitungs- und Magazins Leser, egal ob digital oder analog verringert hat (vgl. M5).
Dies lässt vermuten, dass die Nummer derer, die ihre Informationen fast ausschließlich den sozialen Medien entnehmen, steigt. Wie sehen die Auswirkungen dieser Tatsache auf die Politik aus? Sind Soziale Medien Retter oder vielleicht sogar vielmehr Gefährder der Demokratie?
Medien sind in einer jeden demokratischen Gesellschaft von unabdinglicher Wichtigkeit. Sie sorgen für einen Austausch zwischen Politikern und Bürgern, und informieren die Bürger über aktuelle Probleme und Entscheidungen, vor denen der Staat steht (M1 Z. 50-62). Mithilfe von Medien bildet sich im Volk eine öffentliche Meinung, welche in einer Demokratie, also der Herrschaft des Volkes, eine entscheidende Rolle trägt. Mit Hilfe dieser öffentlichen Meinung, wissen die Politiker, was das Volk möchte, und sind in gewisser Weise auch dazu gezwungen, entsprechend zu handeln, da es andernfalls zu Aufständen und möglicherweise auch Bürgerkriegen kommen kann. Auf Grund der Wichtigkeit der Medien wird sie allgemein auch als „vierte Gewalt“ betitelt, d.h. sie steht auf einem ähnlichen Level wie z.B. Gesetze oder die Polizei (vgl. M1 Z. 62-78). Verrückt, oder?
Während klassische Medien wie z.B. Zeitungen die öffentliche Meinung durch Ablenkung von der Persönlichen zum Allgemeinen Interesse einheitlich und im Zaum gehalten haben, wirken soziale Medien genau andersherum; sie scheinen die Gesellschaft auseinanderzutreiben. Grund hierfür ist vermutlich der Fakt, dass jeder eine Stimme hat und seine Meinung mit nur einem Knopfdruck in die große weite Welt hinausschreien kann (vgl. M1 Z. 78-88). Durch eben diese Spaltung der Meinungen ist social Media von einem Ort, der noch vor 10 Jahren als Mittel zur Revolution der Demokratie (vgl. M2 Z. 101) gepriesen wurde, zu einem Ort voll Hass und Lügen geworden (vgl. M2 Z. 95-112). Oder ist die Spaltung vielleicht doch daraus entstanden? Vermutlich haben sich beide stetig immer weiter zum Extrem gepusht.
Stimmen von Minderheiten und der politischen Mitte gehen so immer weiter unter; es existiert nur noch Schwarz und Weiß (vgl. M2 Z. 112-119). Die Spannung in der Gesellschaft steigt, und es scheint, wie, als würden nur die negative Nachrichten, welche negative Emotionen wie Wut oder Angst hervorrufen, von den Algorithmen gepusht werden. Natürlich entspricht dies nicht 100% der Realität, aber zum Teil stimmt es eben doch. Alles, was einen Schock-effekt erzeugt, wird weitergeleitet, und kommt gegebenenfalls auch bei einer ganzen Generation an (vgl. M3). (Ein etwas positiveres Beispiel hierfür ist Moo Deng, ihr erinnert euch noch an sie, oder?)
Doch nicht alles, was einen Schockeffekt ha, stimmt auch. Viele Aussagen oder „Fakten“, wie sie uns verkauft werden, sind aus dem Kontext gepickte Halbwahrheiten, welche von bestimmten Gruppen für Propaganda Zwecke genutzt werden. Oft wissen die Mitglieder dieser Gruppen selbst nicht, dass es sich bei ihren Tatsachen um Falschaussagen handelt, es hat ja schließlich niemand mehr Zeit gelesenes auf seine Richtigkeit zu prüfen.
Wo wir schon bei Richtigkeit sind: es gibt auch lebhafte Diskurse über die sprachliche Richtigkeit im Netz (z.B. Gendern). Monika Grittes der CDU behauptet, dass auch diese Angst etwas nicht sprachlich korrekt auszudrücken und Hate zu bekommen, stummstellt. Ich muss mich hierbei jedoch Anatol Stefanowitsch anschließen. Er sagt, dass ein vergessenes Sternchen beim Gendern noch niemandem die Karriere zerstört hat. Vielmehr schient diese Angst wohl daher zu kommen, dass man sich selbst bewusst ist, dass die eigene Meinung kritisch ist. Diese Furcht kann also auch etwas Gutes sein, indem sie veraltete Denkweisen zerbricht und somit zu einer Revolution in der allgemeinen politischen Denkweise sorgt (vgl. M4). Solches führt in einer Demokratie oft zur Umschreibung und Erneuerung der Gesetze, hat also einen direkten Einfluss auf unser tägliches Leben.
Marina Weisband vermutet, dass durch all diese aufeinandertreffenden Meinungen auch der Jugend die Lust an Politik vergeht. Sie fühlen sich, wie als ob ihre Stimme unwichtig ist, da die Politiker ja eh machen, was sie wollen. Sie behauptet, außerdem, dass das Schulsystem und der Strikt vorgeschriebene Alltag, der damit einhergeht, sowie das Benoten unserer Fähigkeit sich unwichtige Dinge zu merken dazu beiträgt (vgl. M2).
Ich fühle mich auch manchmal ungehört und übersehen, doch Dinge sind nicht immer so wie sie scheinen. Die Jugendwahlen finden genau dafür statt: um herauszufinden, was IHR denkt. Eure Stimme und Meinung zählen, besonders später, wenn ihr in der richtigen Wahl wählen dürft. Deshalb ist es sehr wichtig informiert zu bleiben, und das am besten mit Hilfe von legitimen und geprüften Quellen.
Ferah A., Q2